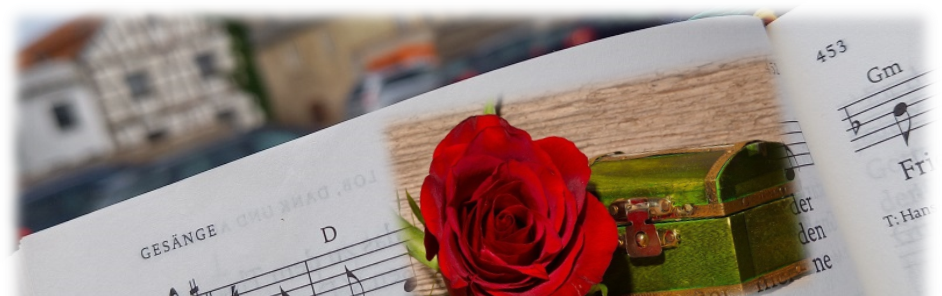Schatzkiste Gotteslob 2023
"SCHATZKISTE GOTTESLOB"
Eine Reihe mit dem Titel „Schatzkiste Gotteslob“ erwartet Sie im Pfarrbrief und hier auf der Homepage. Darin möchte ich ihnen alte und neue Lieder unseres Gesangbuches nahe bringen. Aber auch Gebetstexte sollen hier vorgestellt und für den persönlichen Gebrauch empfohlen werden.
Konrad Perabo, Pfarrer
"In das Warten dieser Welt" - Gotteslob Nr.: 749 (Dezember 2023)

Mit dem Jahresende sind wir wieder im Advent mit seinen schönen Liedern angekommen. Eines davon trägt den Titel „In das Warten dieser Welt“ und steht unter der Nummer 749 im Gotteslob.
Der Text stammt von Johannes Jourdan, der als evangelischer Pfarrer und Lieddichter im hessischen Darmstadt wirkte. Dieser hat auf das englische Weihnachtslied „Hark! The Herolds Angels sing“ aus dem 18. Jahrhundert zurückgegriffen, das sich wegen seiner bekannten Melodie von Felix Mendelssohn-Bartholdy bis heute großer Beliebtheit erfreut. Doch während der englische Klassiker nur das Geschehen an der Krippe von Bethlehem im Auge hat, legt Jourdan den Schwerpunkt auf die adventliche Erwartung, die für uns Christen zwei Richtungen kennt.
Das wird bereits in der ersten Strophe deutlich. Wenn vom „Warten dieser Welt“ die Rede ist, dann ist damit nicht nur die hoffnungsvolle Freude auf Weihnachten gemeint, die wir uns im Advent zu eigen machen. Auch in unseren manchmal dunklen Zeiten warten wir heute auf die leuchtenden Zeichen, die uns die Erlösung in der Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten ankündigen.
Diese Zeichen können aber nur „weit entfernt von dem Gedränge“ wahrgenommen werden. Dass damit mehr als eine Einladung zu adventlicher Ruhe und Besinnung gemeint ist, zeigt uns die zweite Strophe.
Denn im „Abseits“ finden sich diejenigen, die das tröstende Wort besonders nötig haben. Gott „ist nahe dem, der weint“. Ihnen ist „das Licht der Hoffnung“ besonders zugesagt.
Doch das Warten kann ermüdend sein. Daher kündigt uns die dritte Strophe Gottes Heiligen Geist an, der, wie Paulus sagt, das erste „Angeld auf unsere Erlösung“ ist. „Wie ein frischer Morgenwind“ wirkt er belebend auf uns ein und bewahrt uns in hoffnungsvoller Geduld.
Die Botschaft, die den Advent erhellt, erklingt dabei jeweils im Refrain: „Sehet auf, der Retter kommt.“ Die alte Verheißung des Propheten Jesaja ermuntert auch uns, nicht den Kopf hängen zu lassen. Gott hat seine Verheißung an Weihnachten schon einmal erfüllt. So können wir auch heute vertrauensvoll ins neue Jahr und in die Zukunft gehen, „denn der Herr erlöst sein Volk wunderbar zu seiner Zeit“.

Mitte November feiern wir den Gedenktag der Hl. Elisabeth von Thüringen.
Zum 750. Jahrestag des Todes dieser großen Heiligen der Nächstenliebe verfasste der Erfurter Theologe Claus-Peter März das Lied „Wenn das Brot, das wir teilen“, das sie unter der Nummer 470 in unserem Gesangbuch finden.
Die schwungvolle Melodie aus der Feder des Leipziger Kirchenmusikers Kurt Grahl hat dieses geistliche Lied zugleich zu einem Ohrwurm gemacht. Kein Wunder, dass es nach seinem Bekanntwerden auf dem Katholikentag 1982 seitdem auch bei uns gerne im Gottesdienst gesungen wird.
In der ersten Strophe erinnert uns das Lied an das Rosenwunder, das Elisabeth, die gegen den Willen ihres Mannes Brote zu den Armen brachte, der Legende nach vor der Entdeckung bewahrte, weil die Wachen im Korb nur Rosen vorfanden.
Die Rose als Symbol der Liebe, in die sich das geschenkte und geteilte Brot verwandelt, offenbart hier aber auch die tätige Liebe zu den Armen und
Hilfsbedürftigen, um die es auch in den weiteren Strophen geht.
Und dabei wird uns bewusst, dass der Schenkende immer zugleich auch Beschenkter ist, weil „die Hand, die wir halten, uns selber hält“ (wie am Bett eines Kranken oder Sterbenden) und „das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt“ (denken sie nur an den Heiligen Martin). So können aus Schmerz und Leid, die wir mit anderen tragen, für beide Seiten Trost und Hoffnung „erblühen“.
Natürlich bleibt das Lied nicht bei der zwischenmenschlichen Ebene stehen, sondern öffnet durch die Anspielung auf zentrale Bibeltexte auch die geist-liche Dimension dieses Tuns. Schon die zweite Strophe erinnert uns durch einen Verweis auf die Gerichtsreden Jesu (Mt 26,40) daran, dass „das Leid jedes Armen uns Christus zeigt“.
Und der Refrain, der das Bild der himmlischen Gottesstadt (Offb 21) aufgreift, macht uns deutlich: In einer Gemeinschaft, die so miteinander umgeht, ist das Himmelreich, das Jesus verkündet hat, schon angekommen, weil hier selbst „der Tod, den wir sterben, vom Leben singt“. – Was für eine tröstliche Perspektive, gerade im „Totenmonat“ November.

Eigentlich wollte ich ihnen diesmal einfach nur ein Lied zum Erntedankfest vorstellen, das wir im Oktober ja wieder gemeinsam feiern werden.
Daher habe ich mich für das Lied „Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde“ entschieden, das sie im Gotteslob unter der Nummer 467 finden. Nicht zuletzt wegen seiner schwungvollen Melodie, die im tänzerischen 6/4-Takt mehr als eine Oktave umgreift, wird dieses Lied auch 350 Jahre nach seiner Entstehung heute noch gerne gesungen.
Doch was ich bei der Beschäftigung mit diesem Lied entdeckte, hat mich selbst überrascht. Ursprünglich war dieses Lied, das wir heute im Abschnitt „Schöpfung“ des Gotteslobs finden, ein Weihnachtslied (zumindest die erste und letzte Strophe). Im Straßburger Gesangbuch von 1697 war denn auch ein etwas anderer Kehrvers zu lesen: „Auf Erden hier unten, im Himmel dort oben, das Kindlein im Krippelein wollen wir loben.“ Himmel und Erde, die Elemente „Erd, Wasser, Luft, Feuer“, sowie alle „Menschen und Engel“ sollten in die Freude über die Geburt des Erlösers einstimmen.
Erst durch die vier Strophen (2-5), die die Theologin Maria Luise Thurmair 1963 hinzudichtete, erhielt das ursprüngliche Weihnachtslied einen neuen Kontext als Schöpfungslied.
Dabei hat sich die Dichterin von Psalm 148 inspirieren lassen, der den Titel „Lobpreis auf den Herrn, den König des Kosmos“ trägt. Wie die Verse des Psalms, so durchmessen auch die Strophen unseres Liedes die ganze Schöpfung von den Gestirnen und den Weiten des Weltalls, bis hin zum kleinsten „Gelaich und Gewürme“. Alle Regionen unserer Welt von den „Tiefen des Meeres“ bis zu „Wüsten und Weiden, Gebirg und Geklüfte“ werden mit ihren pflanzlichen und tierischen Bewohnern einbezogen. Und auch bei der fünften Strophe, die ausschließlich dem Menschen gewidmet ist, ist deutlich zu erkennen, dass wirklich an alle gedacht werden soll.
Ich bin froh über meine kleine Ent-deckung zur früheren Gestalt dieses Liedes, denn sie erinnert mich daran, dass Christus Ursprung, Mitte und Ziel seiner Schöpfung ist. Mit ihm darf ich nicht nur am Erntedankfest dankbar sein für alles, was ist und auch Sie dazu einladen: „Den gütigen Vater, den wollen wir loben.“

Wenn ich mit Ihnen diesmal das Lied „Singt dem Herrn ein Neues Lied“ betrachte, das Sie unter der Nummer 409 im Gotteslob finden, werden viele denken: Ach, wieder nur ein Loblied.
Georg Alfred Kempf, ein evangelischer Theologe aus dem Elsass, hat in konsequenter Anwendung von Versmaßen und Reimen biblische Motive verarbeitet. Dabei hat er sich von verschiedenen Psalmen wie auch Cantica-Texten des Buches Deuteronomium und der Klagelieder das Jeremia inspirieren lassen. Was daraus entstanden ist, kann sich sehen lassen. Bis heute wird das Lied im Gottesdienst gerne gesungen.
Das liegt natürlich auch an der Melodie, die der Komponist Adolf Lohmann beigesteuert hat. Sie ist nicht nur sehr eingängig, sondern unterstreicht musikalisch die sprachliche Struktur des Lied-Gedichtes.
Doch letztlich ist es der geschichtliche Kontext, der dieses Lied so besonders macht. Geschrieben wurde es im Jahr 1941, kurz nachdem das Elsass von Nazi-Deutschland überfallen wurde; eine traumatische Erfahrung auch für den Lied-Dichter. Und so bekommen die Zeilen des Liedes eine unerwartete Tiefe.
„Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll’s euch wehren“ – nicht einmal die neuen Besatzer.
Denn dieser Gesang kann Wut und Trauer mindern, weil durch ihn die Verbundenheit mit Gott ausgedrückt wird, „der auch heut noch Wunder tut“.
„Täglich“, so lautet das zentrale Wort der zweiten Strophe, das an die Bitte um das tägliche Brot im Vater unser erinnert. Gott schenkt, was für den Tag gebraucht wird, auch wenn „unser Weg durch Nacht“, durch die Nacht von Terror und Krieg führt.
Die dritte Strophe ist der Erinnerung gewidmet. „Hat er nicht zu aller Zeit uns bisher getragen?“ Denn aus den Erfahrungen, die bisher gemacht wurden, kann jetzt die Kraft gefunden werden, dass „in dieser Zuversicht darf sie’s fröhlich wagen“.
Wenn die letzte Strophe die Aufforderung der ersten aufnimmt, dann schließt sie auch uns, die Menschen anderer Orte und Zeiten ein. Welche Herausforderungen uns auch immer erwarten: „Allsoweit die Sonne sieht, singt dem Herrn ein neues Lied, lasst es hell erklingen.“

Ein Segenslied soll Sie durch die kommenden Sommermonate begleiten.
Es trägt den Titel „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ und ist unter der Nummer 453 im Gotteslob zu finden.
Die Anfänge dieses Liedes sind diesmal nicht im Text, sondern in der Musik von Anders Ruuth zu finden. Der argentinische Theologieprofessor war von den gewaltsamen politischen Unruhen, die Ende der 60er Jahre in seinem Heimatland um sich griffen, so erschüttert, dass er die inständige Bitte um den Frieden des Auferstandenen „La paz del Senor“ in die eingängigen Melodien und Akkorde eines Liedes kleidete.
Der bekannte christliche Liedtexter und evangelische Pfarrer Eugen Eckert hat diese Melodie aufgegriffen. In den vier Strophen, die er neu dazu dichtete, lässt er uns anhand von biblischen Beispielen verstehen, was Gottes Segen damals und auch heute bedeuten kann.
Mit der ersten Strophe schauen wir auf das zentrale Ereignis in der Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes zurück: die Befreiung aus Ägypten und der Zug durch die Wüste ins Gelobte Land. Gott hat ihm einen beschwerlichen Weg in die Freiheit eröffnet, doch er bleibt als „Quelle und Brot in Wüstennot“ an seiner Seite. – Wie gut, wenn auch wir diese Gewissheit haben dürfen, wenn wir „Wüstenzeiten“ durchzustehen haben.
In der zweiten Strophe klingt der „Aaronitische Segen“ (Num 6,24ff) an, der am Ende von Gottesdiensten gerne erbeten wird. Gerade in Not und Leid ergeht so unsere Bitte an Gott: „Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten“.
Die dritte Strophe ist inhaltlich mit den letzten Bitten des „Vater unser“ verbunden. Wir sind dem Bösen nicht schutzlos ausgeliefert. Wo wir uns ihm entgegenstellen ist Gott für uns „Hilfe und Kraft, die Frieden schafft.“
Die letzte Strophe schließlich erbittet mit dem Segen auch den Heiligen Geist, der uns in der Verbundenheit mit Gott hält und uns damit wirklich „Leben verheißt“.
Seine belebende Kraft wünsche ich Ihnen gerade jetzt, in der Ferien- und Urlaubszeit. Und wo auch immer Sie diese Zeit verbringen werden, begleite Sie sein Segen: „Gott, sei mit uns auf unseren Wegen“.

Diesmal darf ich ihnen eine echte Rarität aus der Schatzkiste Gotteslob vorstellen.
Passend zur Jahreszeit, in der in unserer Pfarrei viele Trauungen stattfinden, schauen wir uns das einzige Kirchenlied unseres Gesangbuchs an, das sich ausdrücklich dem Thema „Ehe“ widmet. Sie finden es unter der Nummer 499. Es trägt den Titel „Gott, der nach seinem Bilde“.
Schon der Titel ist eine deutsche Übersetzung. Denn den Text dieses Liedes verdanken wir im Original dem niederländischen Theologen Huub Oosterhuis, der dann von Nikolaus Greitemann und Peter Pawlowsky ins Deutsche übertragen wurde. Die Melodie hat der protestantische Komponist Johann Crüger beigesteuert. Leider ist sie den meisten unbekannt und wenig eingängig. Daher wird häufig die Alternativmelodie von GL 395 genommen, mit der das Lied bei Trau-ungen inzwischen auch schon öfter gesungen wurde.
Inhaltlich setzt das Lied in der ersten Strophe bei der Schöpfungsgeschichte an. Gott, der weiß, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein bleibt, „hat uns seit je zur Freude einander zugedacht“. Und die Verbindung, die Mann und Frau miteinander eingehen, wird zum sakramentalen Zeichen. Wie Christus seiner Kirche in den Zeichen nahe ist, so sollen auch sie „einander Wort und Treue, einander Brot und Wein“ sein.
Die zweite Strophe spricht von der Notwendigkeit der Liebe für den Menschen. Erst da, wo ich mich von einem anderen geliebt und verstanden fühle, beginne ich mich selbst zu verstehen. Die Erfahrung dieser liebenden Annahme, die bis in die körperliche Intimität hineinreicht, ist das Geschenk, das die Ehepartner einander machen dürfen. Oosterhuis hat das mit den Worten beschrieben, dass die beiden „von nun an in nichts mehr ganz allein, vereint an Leib und Herzen einander Antwort sein“ dürfen.
Die dritte Strophe öffnet schließlich die Gemeinschaft des Paares auf Gott hin. Als Christen sollen die beiden wissen, dass sie den vor ihnen liegenden Lebensweg nicht allein zu gehen haben. In Anlehnung an die Emmausgeschichte ergeht an das Paar die Verheißung: „ So wird es bei euch bleiben im Leben und im Tod, denn groß ist das Geheimnis, und er ist Wein und Brot.“ Eine solche Verheißung kann durchs ganze Leben tragen.
Konrad Perabo, Pfarrer

Da in diesem Jahr der Marienmonat Mai komplett in der Osterzeit liegt, habe ich mich diesmal für ein österliches Marienlied entschieden und möchte mit ihnen das Lied „Lasst uns erfreuen herzlich sehr“ näher betrachten.
Sie finden es im Gotteslob unter der Nummer 533.
Die Sprache und die blumigen Bilder, die darin verwendet werden, sind für uns heute vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist aber auch kein Wunder, wurde das Lied doch bereits im Jahr 1623 geschrieben. Der Text stammt aus der Feder des Jesuiten Friedrich Spee, dem wir auch so bekannte Lieder wie „O Heiland reiß die Himmel auf“ oder „Zu Bethlehem geboren“ verdanken.
Auch wenn uns der Komponist der Melodie nicht namentlich bekannt ist – sie ist wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie der Text in Köln entstanden –, so erfreut sie sich doch bis heute großer Beliebtheit. Diverse Komponisten haben sie seither auch für die festliche Vertonung anderer Liedtexte (z.B. Komm Heiliger Geist der Leben schafft) entliehen und bearbeitet.
In den Strophen entwirft Spee ein Gegenbild zur bekannten „Mater dolorosa“, der leidend-trauernden Gottesmutter, die unter dem Kreuz steht oder in den Pieta-Darstellungen den toten Sohn auf dem Schoß trägt.
Mit Ostern sind die Tage der Passion jedoch vorbei, die Jesu Würde als Gottes Sohn wie im Nebel verhüllt hatten. „Nun glänzt der lieben Sonne Strahl“, das Licht der Auferstehung, das wieder Klarheit schenkt. Zugleich ist der Schmerz der Freude gewichen. „Maria seufzt und weint nicht mehr.“ Ihr Herz, das in der Passion vom Schmerz durchbohrt wurde, ist nun ein „freudenreiches Herz“. Die fast schon rhetorische Frage an die Gottesmutter nach dem Grund ihrer Freude, wird mit der Auferstehung Jesu beantwortet. „Kein Wunder, dass du fröhlich bist.“
Selbst die Wundmale Jesu, die in der Passion besonders herausgestellt wurden, werden hier umgedeutet. Nun sind sie nicht mehr die Zeichen seines Martyriums, sondern Quellen des Heiles, aus denen „fünf Freundenseen, fünf Freudenmeer“ hervorfließen. Maria ist ganz in die Osterfreude hineingenommen. „Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt.“ Und wir dürfen singend in dieser Freude „mitschwimmen“. Halleluja!
Konrad Perabo, Pfarrer
Bildergalerie
Heute möchte ich mit Ihnen eines der beliebtesten Osterlieder anschauen, das auch für mich am Fest der Auferstehung nicht fehlen darf. Ich meine das Lied „Das Grab ist leer“, das unter der Nummer 779 in unserem Gotteslob steht.
Seine Ursprünge reichen bis ins Jahr 1777 zurück, in dem es wahrscheinlich von Franz Seraph von Kohlbrenner, einem von der Aufklärung geprägten Universalgelehrten seiner Zeit gedichtet wurde. Von der Ursprungsfassung ist heute jedoch nur noch die erste Strophe übernommen worden, die Mitte des 19. Jahrhunderts um zwei neue Strophen ergänzt wurde.
Die erste Strophe führt uns mit den Frauen am Ostermorgen ans leere Grab und verkündet die Osterbotschaft: „Der Heiland ist erstanden“. Nichts kann den Siegeszug des Auferstandenen aufhalten. „Ihm kann kein Siegel, Grab noch Stein, kein Felsen widerstehn.“ Selbst die Hölle – früher stand dort „der Unglaub“, eine Anspielung auf die Grabwächter der Pharisäer – kann ihn nicht stoppen, weder damals, noch in der Geschichte bis heute.
Die zweite Strophe, die mit einem Zitat aus dem 1. Korintherbrief die Bedeutung der Auferstehung Jesu auch für sein irdisches Wirken unterstreicht, fehlt leider im Limburger Gesangbuch. Ich möchte sie Ihnen dennoch nicht vorenthalten. „Wo ist dein Sieg, o bittrer Tod? / Du selber musst erbeben; / der mit dir rang ist unser Gott, / Herr über Tod und Leben. / Verbürgt ist nun die Göttlichkeit / von Jesu Werk und Wort / und Jesus ist im letzten Streit / für uns ein sichrer Hort. / Halleluja!“
Mit der dritten (im Gotteslob zweiten) Strophe spricht die betende Gemeinde den Auferstandenen selbst an. Sie erinnert sich an die Emmaus-Begegnung und bittet mit den Jüngern damals: „Herr, bleib bei uns, wenn’s Abend wird“, womit natürlich auch der Abend des Lebens gemeint ist, aus dem wir mit ihm „einst glorreich auferstehen“ möchten.
Die Melodie von Norbert Hauner macht bereits durch ihren Fanfarenartigen Beginn deutlich, dass dieses Lied nicht informieren, sondern jubelnd den Ostersieg verkünden will. Wir selbst werden, wenn wir es singen, zu Verkündern der Osterbotschaft, die die Welt verändert, und unterstreichen sie dankbar mit dem dreifachen „Halleluja“ am Ende jeder Strophe.
Konrad Perabo, Pfarrer

Bekehrung, Vergebung und Barmherzigkeit – diese Motive prägen die Öster-liche Bußzeit, die wir in diesem Monat begehen. Diese Motive klingen auch im Lied „Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen“ an.
Sie finden dieses Lied, das aus der Feder des Mainzer Domkapitulars Johann Seuffert stammt, unter der Nummer 266 in unserem Gotteslob. Der Autor hat sich nicht nur die Melodie, sondern auch den Inhalt der lateinische Antiphon „Attende Domine“ als Vorlage genommen, die er in den sieben Strophen anhand von biblischen Motiven entfaltet.
Die ersten drei Strophen sind geprägt vom Ruf zur Umkehr. Am Anfang steht die Gewissheit, dass Gott seinen Sohn nicht zum Gericht, sondern zur Rettung in die Welt gesandt hat (vgl. Joh 3,17). Seine Liebe „ruft die Menschen in das Reich des Vaters.“
Die zweite Strophe erinnert an den Anfang der Lehre Jesu als er verkündete: „Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe“. Und in der dritten Strophe klingt die Mahnung aus Psalm 95 (Vers 7) an, die uns aufruft: „Hört seine Stimme“, und damit auch „ändert euer Leben“.
Wer sich bekehrt hat und in seinen Taten zeigt, dass die Stimme Gottes ihn erreicht hat, der ist bereit, als Christ zu leben. Davon sprechen die folgenden Strophen.
Die vierte Strophe erinnert uns daran, dass wir vom Guten Hirten gefunden (vgl. Lk 15, 3) und „in der Taufe neu geboren“ wurden (vgl. Joh 3,5). Nun dürfen wir aus der „Kraft des Geistes“ unseren Glauben leben.
Unsere Bekehrung und Berufung gilt aber nicht nur uns selbst. Sie bedeutet immer auch Sendung, wie uns die fünfte Strophe erinnert. „Geht hin zu allen, kündet seine Botschaft.“ Und das nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. „Tut Gutes allen“, gerade in der Fastenzeit, denn „dies ist ein Fasten in den Augen Gottes“, wie die sechste Strophe betont.
Die letzte Strophe fasst den geistlichen Weg dieses Liedes zusammen. Wer ihn geht, den nennt Jesus nicht mehr Knecht, sondern Freund (vgl. Joh 15,15). Befreit von den Fesseln der Sünde sind wir – wie einst der verlorene Sohn – eingeladen: „Kehrt heim zum Vater, kommt zum Mahl der Freude.“
Wer könnte, im Vertrauen auf Gottes Hilfe, eine solche Einladung ausschlagen?
Konrad Perabo, Pfarrer

Das Lied, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, hat in seiner Geschichte eine starke Umdeutung erhalten. Sein Ursprung liegt in einem biblischen Text, der mit dem Fest Maria Lichtmess am 2. Februar verbunden ist. Doch inzwischen begleitet es uns durch das gesamte Kirchenjahr.
Ich spreche von dem Lied „Im Frieden dein, o Herre mein“, das sie im Gotteslob unter der Nummer 216 finden.
Als der evangelische Theologe Johann Englisch (Angelicus) 1530 den Text des Liedes dichtete, hatte er sich den Gesang des Simeon, das „Nunc dimittis“, als biblische Vorlage gewählt, die ge-rade in der ersten Strophe auch noch sehr deutlich durchscheint.
Doch aus dem, was Englisch noch als persönliches Gebet um einen friedlichen Tod konzipiert hatte, machte fast 400 Jahre später der Theologe Friedrich Spitta ein Danklied für den evangelischen Abendmahlsgottesdienst.
Was blieb ist die ruhige, meditative Melodie, die der Organist Wolfgang
Dachstein bereits im 16. Jahrhundert komponierte, und die dieses Lied auch im katholischen Gottesdienst zu einem guten Begleiter der Kommunionausteilung werden ließ.
Nun wird „das selge Licht“, das Simeon im Tempel beim Anblick des Jesuskindes besungen hat, auf die Eucharistie bezogen, in der uns Gott hat „den Heiland schauen lassen“.
Die zweite Strophe vertieft diesen Gedanken, indem sie in Christus den erkennt, der mir zugleich „das reiche Mahl der Gnaden“ bereitet hat, aber auch selbst das „Lebensbrot“ ist, das „heilt meiner Seele Schaden“. So geheilt weitet sich mein Blick und nimmt auch all die anderen wahr, „die du geladen“.
Die dritte Strophe hebt die Gemeinschaft, die Communio hervor, die so durch die Eucharistie entsteht. Sie bittet den Herrn, „dass Lieb und Treu in dir uns all verbinden“. Zugleich soll diese Feier aber auch Stärkung zum christlichen Leben sein, in dem „Hand und Mund zu jeder Stund dein Freundlichkeit verkünden“.
Am Ende schließt sich der thematische Kreis mit dem Ausblick auf unsere Vollendung beim himmlischen Hochzeitsmahl und der Hoffnung, dass „den Platz bereit an deinem Tisch wir finden“.
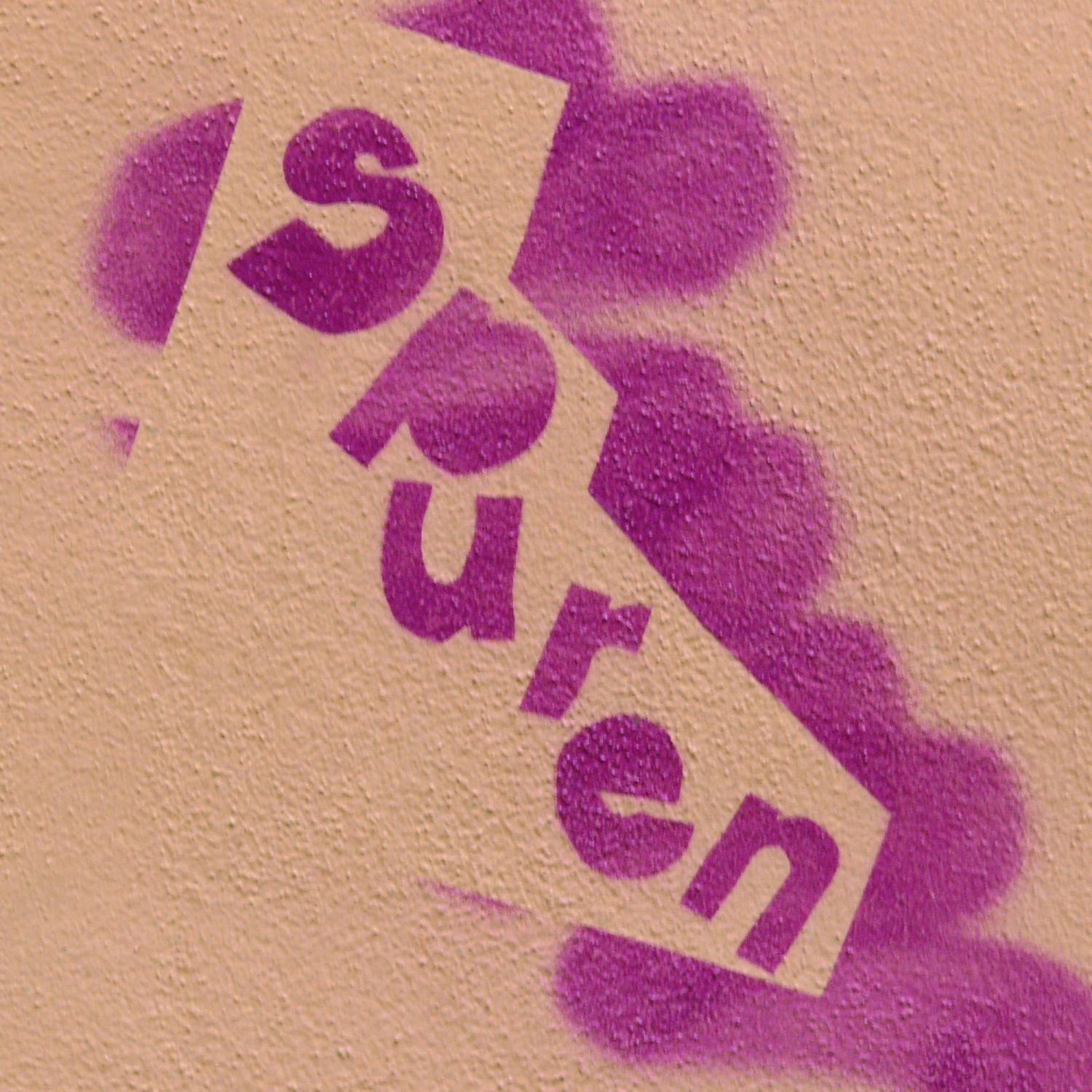
„Gott, du mein Gott, dich suche ich!“ – Passend zu unserem geistlichen Jahresmotto möchte ich ihnen zum Jahresbeginn ein Lied vorstellen, das wir hoffentlich auch das Jahr über immer wieder mit Begeisterung singen können.
Es trägt den Titel „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“. Sie finden es im Gotteslob unter der Nummer 840.
Der deutsche Dominikanerpater Diethard Zils hat den Text des franzö-sischen Priesters und Schriftstellers Michel Scouarnee ins Deutsche übertragen. Zusammen mit der schwungvollen Melodie des griechisch-fran-zösischen Chansonniers Jo Akepsimas wurde so unser Gotteslob um ein hoffnungsvolles Glaubens-Lied bereichert.
Die erste Strophe lädt uns ein, uns „auf unsern Menschenstraßen“ umzu-schauen. Unsere Nachrichten stellen vor allem die Meldungen ins Scheinwerferlicht, die die Welt kalt und grausam erscheinen lassen: Gewalt, Krieg, ungerechtes Leid. Doch es gibt eben auch das andere: Menschen, die einander in der größten Not „Liebe und Wärme“ schenken und damit eine „Hoffnung, die wir fast vergaßen“.
Haben wir hier „Gottes Spuren festgestellt“?
Die zweite Strophe erinnert uns an ein Ereignis in biblischer Zeit. Sie erzählt von den Israeliten, die als Sklaven „durch das Wasser [des Roten Meeres] gehen, das [am Ende] die [ägyptischen] Herren überflutet“. So erreichen sie nach dem Zug durch die Wüste das gelobte Land, dessen Fruchtbarkeit sie überrascht, weil „niemand sie vermutet“ hatte.
Die dritte Strophe schließlich erinnert an die Zeichen Jesu, die er an Armen und Kranken gewirkt hat. An denen sollte schon Johannes der Täufer ihn als den Messias erkennen: „Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten, wie Stumme sprachen.“ Und schließlich wird auch das große Zeichen der Auferstehung Jesu angesprochen, dessen Strahlen „die Nacht [des Todes] durchbrachen“.
„Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen“ fasst der Refrain die Stophen zusammen. Auch wenn wir das Ziel unserer (lebenslangen) Suche vielleicht noch nicht erreicht haben, Gottes Spuren sind damals wie heute unübersehbar. Und sie geben uns auch im neuen Jahr die Zuversicht: „Gott wird auch unsre Wege gehen, uns durch das Leben tragen.“
Konrad Perabo, Pfarrer

„Ihr Tore hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit.“ – Diese Worte aus Psalm 24 werden es wohl gewesen sein, die den evangelischen Pfarrer Georg Weissel zu dem Lied inspiriert haben, das er aus Anlass einer Kirchweihe schrieb, das heute aber das wohl bekannteste und beliebteste Adventslied über die Grenzen der Konfessionen hinweg ist.
Ich spreche natürlich von dem Lied „Macht hoch die Tür“, das sie unter der Nummer 218 im Gotteslob finden.
Als „Herr der Herrlichkeit“ und „König aller Königreich“ stellt uns bereits die erste Strophe den wiederkommenden, endzeitlichen Christus vor Augen, auf dessen Kommen wir uns im ersten Teil des Advents hin ausrichten. Sein Kommen soll uns nicht mit Furcht, sondern mit Freude erfüllen: „derhalben jauchzt, mit Freuden singt.“
Mit der zweiten Strophe jedoch kippt das Bild des allmächtigen, furchteinflößenden Herrschers bereits. „Sanft-mütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter die Barmherzigkeit“ – so steht er nun vor uns.
Mich erinnert dieses Bild an Jesus, der am Palmsonntag in die Heilige Stadt Jerusalem eingezogen ist, damit „all unsre Not zum End er bringt“ durch seinen Tod und seine Auferstehung.
Mit dem Dreischritt „O wohl dem Land, o wohl der Stadt, … wohl allen Herzen insgemein“ bringt uns die dritte Strophe dem kommenden König immer näher. Der „ist die rechte Freudensonn“, die das Dunkel und die Trauer vertreiben will und so für uns zum „Tröster früh und spat“ geworden ist.
Die vierte Strophe spricht uns Sänger selber an und fordert uns auf: „Eur Herz zum Tempel zubereit‘.“ Die Mühe dafür lohnt sich, denn „so kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich“ – eine Erfahrung, die schon den greisen Simeon im Tempel jubeln ließ.
In der letzten Strophe geht es nicht mehr um eine beschreibende Darstellung des adventlichen Kommens Jesu Christi. Nun kommt die Sehnsucht selbst zu Wort, die nur noch ruft: „Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist.“
Ich wünsche Ihnen allen am Ende eines schwierigen Jahres diese freudige Sehnsucht, damit Gott bei Ihnen offene Türen einrennt.
Konrad Perabo, Pfarrer
Seit 2018 beschreibt Pfarrer Konrad Perabo monatlich Lieder, die wir im Gotteslob finden. Hier finden Sie die älteren Ausführungen.
Schatzkiste Gotteslob aus dem Jahr 2018
Schatzkiste Gotteslob aus dem Jahr 2019
Schatzkiste Gotteslob aus dem Jahr 2020
Schatzkiste Gotteslob aus dem Jahr 2021
Schatzkiste Gotteslob aus dem Jahr 2022