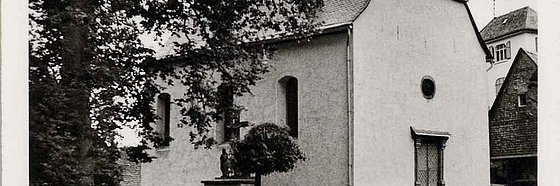Kirchorte
Pfarrkirche Hl. Kreuz Geisenheim

Eine erste Kirche findet sich in Geisenheim als sogenannte Eigenkirche bei einem Fronhof wohl bereits im 8. Jahrhundert. Der Fronhof galt als Eigentum des Reiches und des Königs. Über den König gelangte diese Kirche im frühen Mittelalter in die Obhut des Mainzer Erzbischofs. Dieser übertrug die Kirche 1146 seinem Domkapitel. Zu dieser Zeit bestand wohl eine romanische Kirche, die beareits mit einer Doppelturmfassade ausgestattet war. Bis zur Säkularisation 1803 war das Mainzer Domkapitel als Zehntherr verpflichtet, sich um Bau und Erhaltung der Kirche zu kümmern.
1510 bis 1512 wurde der Chor und die Sakristei der heutigen spätgotischen Kirche errichtet. Dabei wurden im Netzgewölbe des Chores die Wappen des Mainzer Domkapitels angebracht. 1512 bis 1518 baute die bürgerliche Gemeinde an den Chor drei weitere Joche im dreischiffigen Langhaus an.
1816 stellte man erste Schäden an den Türmen fest. Wenige Jahre später war der Zustand der Türme so untragbar, dass sie abgerissen wurden. Es dauerte etwas, bis man sich entschloss zwei neue Türme zu bauen. Man gewann dafür den aus Geisenheim stammenden Bauassessor Philipp Hoffmann (1806-1889). Unter Leitung dieses Architekten des romantischen Historismus wurden 1836 bis 1839 zwei neue Türme errichtet und das Langhaus um zwei Joche erweitert.
Der Südturm wurde 1879 durch einen Blitzschlag geschädigt. Philipp Hoffmann baute ihn nach neuen Plänen wieder auf, so dass auf den ersten Blick beide Türme identisch scheinen, der rechte Südturm bei näherem Hinschauen aber deutlich filigraner gearbeitet ist.
Adresse:
Bischof-Blum-Platz 1
65366 Geisenheim